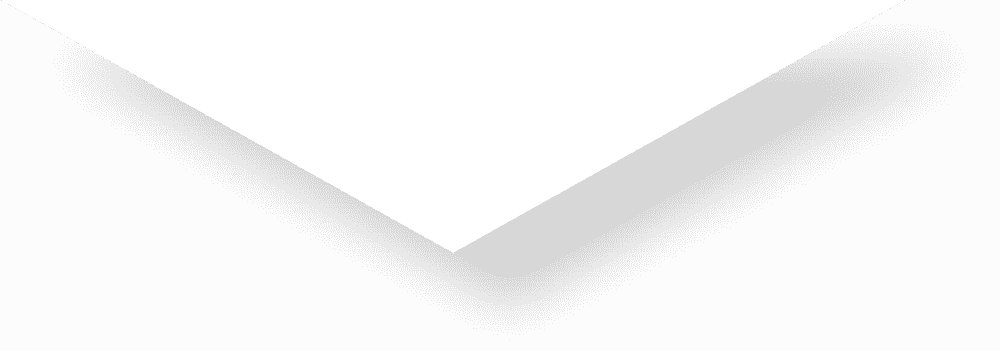„So wahr mir Gott helfe!“ Für Bernd Vogel war dies keine Formel. Es war das ehrliche und leitende Selbstverständnis seines Amtseides. Darüber hinaus war es in Wahrheit seine bestimmende Orientierungs- und Lebensmaxime. Aus ihr erwuchs sein Verständnis von Menschlichkeit, Gemeinwohl, Verantwortung und Wertorientierung in Politik und Gesellschaft. Diese Maxime trug ihn durch Jahrzehnte seines unermüdlichen Engagements in vielfältigen Führungspositionen: in der Partei, in den Ministerpräsidentschaften von Rheinland-Pfalz und Thüringen, in der Konrad-Adenauer-Stiftung, im Zentralkomitee der Katholiken Nicht zuletzt trug sie ihn als einzigartigen Menschen; auch als besonderen Politiker, wie ihn Bundespräsident Roman Herzog einst charakterisierte, „weil er ein lebendes Beispiel dafür ist, dass sich Toleranz und Grundsatztreue, Pflichterfüllung und Offenheit, Realismus und Zuversicht nicht ausschließen müssen.“ Im Gegenteil, hätte Bernd Vogel gesagt - und hat danach gehandelt. Er beherrschte den Diskurs mit Geistesgrößen wie die Kommunikation mit Parteimitgliedern und Landeskindern, immer fähig zuzuhören, oberflächlicher Meinung abzuschwören und Argumente auszutauschen. Doch wo er Gründe sah, verweigerte er auch keinen Widerspruch - Kohl nicht und auch Kardinälen nicht, wie sein Einsatz für Donum Vitae belegt. Dieses Beispiel lebt nun nicht mehr. Bliebe es ein Vorbild, bliebe es ein Gewinn in zerklüfteten Zeiten, die sich offensichtlich aber anders orientieren. Bernd Vogel hat man stets freundlich und zugewandt erlebt. Nicht nur privat: Auch im politischen Diskurs gilt er als Brückenbauer zwischen Menschen und Meinungen, solange sie auf dem ethischen Fundament individueller und demokratischer Freiheit beruhen - das Fundament, das nicht zuletzt Politikern in ihren unterschiedlichen Sichtweisen Orientierung an Gemeinwohl und Verantwortung abverlangt. Die damalige Politikwissenschaft, in der er eigentlich seine Zukunft sah, verstand sich in diesem Sinne geradezu als sozialtherapeutische Antwort auf die Erfahrung zeitgeschichtlicher Wertvernichtung. Diese Symbiose von akademischer Erkenntnis und persönlicher Einstellung blieb seine konsequente Wegweisung auf dem Lebensweg, der dann doch in die Politik führte und schließlich von ihm auch als persönliche Pflicht und Gestaltungschance verstanden worden ist. Um diese Chance zur Verwirklichung des Gemeinwohls wahrzunehmen, fordert Bernd Vogel von sich und seinesgleichen z.B. in seinem Politikartikel für das Staatslexikon ausdrücklich eine vor Populismus und Opportunismus bewahrende Grundwertorientierung sowie Charakterfestigkeit und zukunftsfähige rationale Gestaltungskompetenz. Für den Christen definiert er Politik als Versuch, „mit den Mitteln des Rechts, aber auch der staatlichen Gewalt, die von Gott verliehene unantastbare Würde des Menschen zu schützen und zu erhalten.“ Gott als Quelle staatlicher Ordnung - für den Christen, seine Ziele, sein Handeln: eine legitime Position im modernen Verfassungsstaat, der, wie er weiß, weltanschaulich neutral sein muß, aber nicht wertneutral sein darf. Schon um Macht zu begrenzen. Jedenfalls stützen diesen Staat christliche Werte, wenn auch nicht allein. Für Bernd Vogel folgt daraus auch das Bekenntnis zur christlichen Sozialethik und zu aus ihr folgender Partizipation an der Gestaltung von Staat und Gesellschaft, „aber nicht in Abhängigkeit von einer außerstaatlichen Macht“, fügt er hinzu, die Eigenständigkeit der Laien betonend. Und dass diese Orientierung nicht exklusiv in C-Parteien konzentriert ist, weiß er auch. Dass innerparteilicher Pluralismus, gesellschaftliche Relativierung widerspiegelnd, zunehmend an dieser Basis nagte, veranlasste ihn, in der Adenauer-Stiftung mit renommierten Experten eine Grundsatzstudie über Menschenwürde und politisches Handeln aus christlicher Verantwortung zu edieren. Man sollte sich ihrer erinnern! Bernd Vogels unerschütterliche Verankerung im Glauben und in der christlichen Ethik sind aufs engste mit seinem Verhältnis zum ND von Jugend auf verbunden. Als Schüler in der Gießener Diaspora konfrontiert ihn ein Geistlicher mit dem herausfordernden Hirschbergprogramm. Er gibt dem jungen Schüler den Auftrag, eine Gruppe zu gründen. Der tat es mit Erfolg und lernte bei ihrer Führung jenseits des Programmatischen manche für das spätere Leben hilfreiche soziale Tugend und Technik. Damals lebten Tradition und Milieu der Jugendbewegung wieder auf, welche der Nationalsozialismus ja gestohlen hatte. Die Einladung „zu strenger, an christlichen Grundsätzen orientierter Lebensführung“, als die Bernd Vogel die „Lebensgestaltung in Christus“ verstand, vertiefte sich dann in den 50er Jahren in München mit Freunden, die es ernst meinten, wie er schreibt: Christuskreise, neue Formen der Messfeier, Gruppenstunden, Zeltlager, Fahrten - bis nach Rom. Prägend war nicht die Tagespolitik, vielmehr die Auseinandersetzung mit Grundfragen der katholischen Soziallehre und mit den Sozialenzykliken Rerum Novarum und Quadragesimo Anno. Diese Freundschaften währten über Jahrzehnte, wie auch die Einbindung Bernhards in den Bund, die Generationen übergreifend auch hier neue Brücken schlug. Wo immer er lebte, fügte er sich aktiv und ansprechbar ein. Und wo überregional Rat und Hilfe (oder ein Diskurs wie im Politischen Arbeitskreis) gebraucht wurde, verweigerte er sich nicht. Typisch: Nicht lange vor seinem Tod bat er einen alten Freund, sich um einen vereinsamten Bundesbruder zu bemühen. Die Vollzugsmeldung kommentierte er mit der Bemerkung: „Wie sind halt NDer!“ Sind wir noch so? Schließlich ist dieses Bernd-Vogel-Generations-Milieu, das Jungengemeinschaft, Hochschul- und Männerring umschloss, entrückt. Neue Zeiten müssen wohl Institutionen und Organisationen wandeln, ethische Orientierungen und emotionale Einstellungen aber nicht. Bernd Vogel würde uns Optimismus anraten. Heinrich Oberreuter
Weiterer Nachruf auf der Seite des Zentralkommittee der Katholiken (ZdK): https://www.zdk.de/presse/presse-nach-tags/2025/wir-verlieren-einen-wahren-homo-politicus