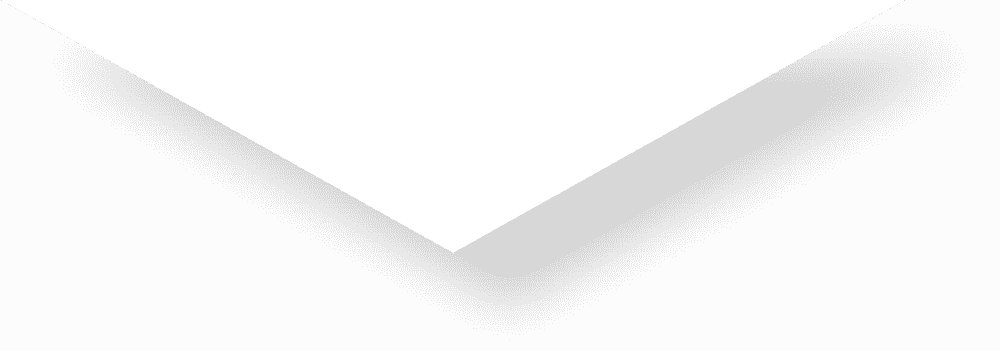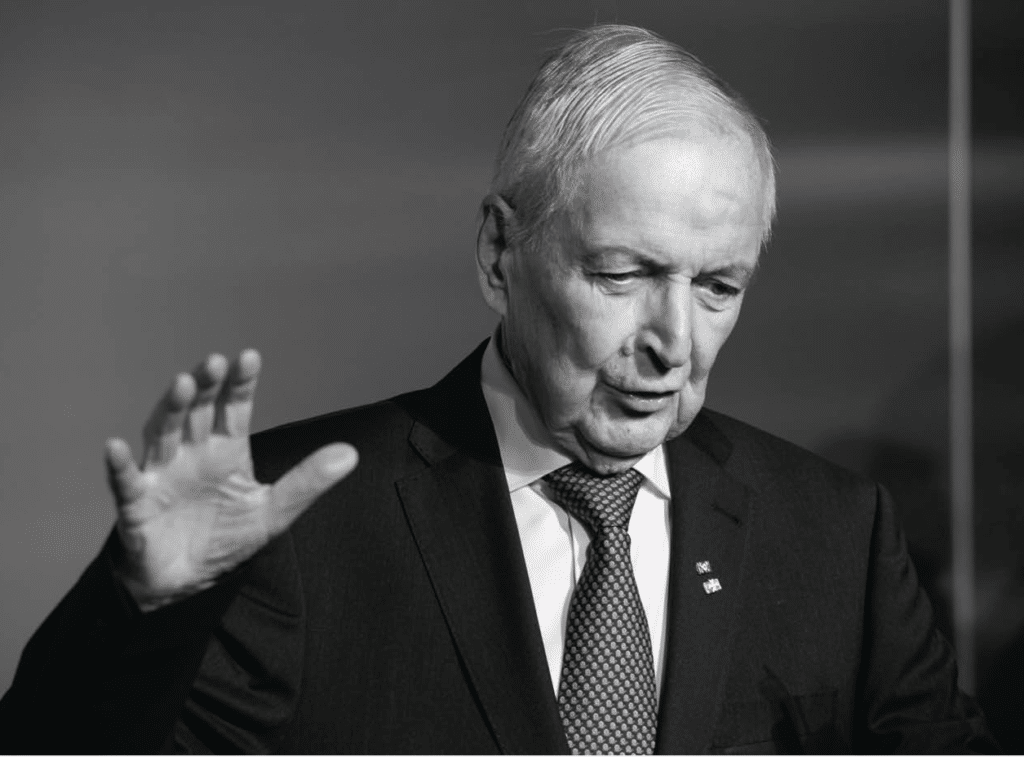Mitschrift des Vortrags von Klaus Töpfer auf dem ND-Kongress am 28.03.2008 in Halle
Über viele Jahre bin ich Mitglied der Sankt Ansgar Gruppe des ND in Höxter gewesen. Das ist bemerkenswert. Denn Höxter liegt im Corveyer Land. Corvey, die alte Klostergründung, wurde von Benediktinermönchen aus Corbie an der Somme aufgebaut und ist dem Heiligen Vitus geweiht. Von dort, aus dem Corveyer Land, sind Sankt Ansgar und andere aufgebrochen nach Norden und haben den Glauben Gottes verkündet. Das Bistum Hamburg ist heute wieder diesem Heiligen geweiht. Das war der Anfang einer Globalisierung: „Gehet hin in alle Welt“. Nichts Neues also, wenn wir heute über globale Wirkungen sprechen.
Titel dieses Bundestages ist Klimawechsel; es ist, wie man sieht, ein Titel ohne Anführungsstriche. Aus dem Programm geht hervor: Es wird über das Klima gesprochen. Kollege Graßl spricht ganz klassisch über den Klimawandel. Bei der Ankündigung meines Vortrags heißt es dann jedoch: Der globale „Klimawechsel“ und die Rolle der Politik. Interessanterweise hat man hier „Klimawechsel“ in Anführungszeichen gestellt. Da wird man nachdenklich. Man könnte sagen: Immer wenn es um Politik geht, muss man Anführungsstriche mitdenken. Aber das wäre etwas zu vordergründig. Vielleicht muss man sich erst einmal fragen, um welches Klima, das es zu wechseln, zu ändern gilt im globalen Bezug, handelt es sich? Um welchen „Klimawechsel“ soll sich Politik kümmern? Natürlich merkt, wer in der Welt tätig ist, dass es ein Klima in dieser Welt gibt, das zu verändern, zu wechseln möglicherweise ganz hilfreich wäre. Dass es darum gehen kann, zu fragen, ob man mit einem nicht veränderten Klima diese Welt denn friedlich in die Zukunft führen kann. Muss man nicht etwas ändern, muss man nicht etwas verrücken?
Ostern ist das Fest der Verrückten, sagte der Pfarrer in einer bemerkenswerten Osterpredigt in der Pfarrkirche St. Nikolai in Höxter. Fest der Verrückten: „Da kann kein Siegel, Grab noch Stein…“. An und mit Ostern wird etwas verrückt, verändert. Die Welt nach Ostern ist eine andere als die Welt vorher: es ist eine verrückte. Sicherlich sind viele der ersten Christen als Verrückte bezeichnet worden. Gibt es also etwas zu verrücken oder ist die Tatsache, dass Klimawechsel politisch sein soll, die Aufforderung, alles zu tun, damit sich nichts verändert?
Das Klima in einer zweigeteilten Welt
Wie sieht die Welt aus, in der wir leben? Es ist eine – in hohem Maße – zweigeteilte Welt. Wir reden so einfach von der globalisierten Welt, in Wahrheit ist sie massiv zweigeteilt. Ich mache mir das immer klar an der Tatsache, dass ein und derselbe Begriff in uterschiedlichen Teilen der Welt genau konträre Bedeutung hat. Wenn wir Ernährungspolitik sagen, dann heißt das bei 20 % der Weltbevölkerung, bei denen, die so wie wir hoch entwickelt sind: bewusster essen. Was können wir tun, dass unsere Kinder nicht noch dicker werden? Wie können wir weniger und wie können wir bewusster essen? Bei 80 % der Weltbevölkerung heißt Ernährungspolitik: Wie bekommen wir etwas zu essen? Mehr als 800 Millionen Menschen in dieser Welt leben immer noch unter den Bedingungen des Hungers. Deswegen heißt eines der Entwicklungsziele für dieses Millennium, diese Zahl zu halbieren. Wir sind nicht dabei, dieses Ziel zu erreichen, eher im Gegenteil. Ein anderes Beispiel: der Begriff Bevölkerungspolitik. Bei den genannten 20 % sind das alle Bemühungen und Maßnahmen, damit die Gesellschaften mehr Kinder haben. Und bei diesen 20 % sind viele Menschen der Überzeugung, bei den übrigen 80 % müsse alles getan werden, dass die Weltbevölkerung nicht weiter ansteigt.
Eine zweigeteilte Welt. Bei einem Besuch in Indien hat man mir diese Zweiteilung fast brutal gezeigt und gesagt, in den so genannten hoch entwickelten Ländern seid ihr alt, satt, dekadent, und wir in den so genannten Entwicklungsländern sind jung, hungrig, dynamisch. Die zweigeteilte Welt fordert Konsequenzen. Zwei Bilder, die wir in einem Umweltprogramm der Vereinten Nationen entwickelt haben, zeigen das. Wir haben uns gefragt, wie sähe diese Welt aus, wenn sie nicht geformt wäre in den uns bekannten geographischen Linien, sondern durch die Anzahl der jungen Menschen unter 15 Jahren. Dann sähe die Welt so aus (s. Abbildung 1): Afrika ist sehr dick, ebenso Indien. China verfolgt, wie man weiß, die sogenannte 1-Kind-Politik, mit massiven Konsequenzen in der Zukunft: Eine typische Problematik: man bewältigt aktuelle Probleme, indem man größere für die Zukunft anhäuft. Denn China ist ein Land, in dem die Sozialsicherung, wie in vielen anderen Entwicklungsländern und wie bei uns in der vor mir liegenden Generation, natürlich über die Familie läuft. Beide Amerikas sind sehr dünn, aber auch die Gestalt Europas ist eine andere als die bekannte.
Wie sieht die Welt aber aus, wenn wir sie nach dem Bruttosozialprodukt schneiden? (s. Abbildung 2) Ganz anders. Zu sehen sind drei große Luftballons, und Afrika verkommt zu einem Wurmfortsatz, es ist kaum noch erkennbar. Im Vergleich der beiden Abbildungen – die beiden Amerikas hier und dort, Afrika, Indien hier und dort – kann man nur eines konstatieren: In einer Welt, in der sich diese gezeigten Verhältnisse nicht ändern, werden wir keine friedliche Zukunft haben. Es ist einfach zu verstehen, dass solche Unterschiede zum Ausgleich drängen. Das kennt man von jeder Talsperre. Solange die Mauer hält, kann man das Wasser stabil halten. Wenn sie urplötzlich nicht mehr hält – in Höxter haben wir das am Ende des Krieges erlebt –, gleichen sich die Unterschiede aus.
Diese geteilte Welt ist in vielen Bereichen eine globalisierte Welt. Das bedeutet: Entweder werden wir es schaffen, im dünnen Bereich der Bruttosozialprodukt-Welt Entwicklung zu schaffen, oder im anderen Bereich werden Anpassungsprozesse stattfinden, vornehmlich durch Wanderungsbewegung, durch Migration. Wo die beiden Bereiche heute aufeinanderstoßen, steht, zum Beispiel zwischen den USA und Mexiko, eine Mauer: Eine Hightech- Mauer zum Schutz gegen den Ausgleichsprozess durch Wanderung. Hier, in unserer Gesellschaft, funktionieren großartige Verdrängungsmechanismen. Wer verfolgt, was in dem – technisch gesprochen – Austauschprozess zwischen Afrika und Europa passiert? Allein die Zahl der afrikanischen Flüchtlinge, die in Booten von Westafrika auf die Kanarischen Inseln zu gelangen versuchen, geht in die Tausende. An anderen Stellen, zum Beispiel in der Ägäis vor der türkischen Küste, ist es ähnlich. Sie sind schon keine Meldung mehr wert. Die Reaktion auf diesen Druck des Ausgleichs ist klassisch. Die Innenminister der Europäischen Union machen sich Gedanken darüber, welche neue Grenztruppe man bilden müsse und welche Anschaffungszahl von Patrouillenbooten man braucht, um die Einwanderung zu stoppen. Ich wünsche all denen, die glauben, diesen Austausch verhindern zu können, indem sie Mauern errichten und Grenzpatrouillen einsetzen, viel Erfolg. Es wird ihnen nicht gelingen.
Das ist das Klima unserer Welt: Auf dem europäischen „Ballon“ liegt das durchschnittliche Einkommen der Menschen bei etwa 30.000 Euro pro Jahr. 14 Kilometer südlich, auf der anderen Seite der Meerenge von Gibraltar, gibt es in Maghreb ein Pro-Kopf-Einkommen von 4- bis 5.000 Dollar. In der Subsahara dann von nicht einmal 1.000 Dollar. Wer kann glauben, dies sei eine stabile Situation? Sie ist es ganz sicher nicht. Deswegen hat schon Papst Paul VI. zu Recht gesagt, Entwicklung ist der neue Begriff für Frieden. Es geht um Friedenspolitik, nicht um Almosen. Wie können wir in einer Welt eine Perspektive schaffen für immer mehr Menschen?
Als ich vor ca. 70 Jahren geboren wurde, hatte diese Welt 2,7 Milliarden Einwohner, jetzt sind wir bei 6,7 Milliarden, und obwohl sich die Zuwachsrate abschwächt, werden wir bis zum Jahr 2050 mindestens 8,5 Milliarden Einwohner haben. Die Menschen, die dann leben, gibt es zum Teil schon. Meine Enkelkinder werden dann knapp über 40 Jahre alt sein – in einer Welt von 8,5 Milliarden. Glaubt irgendjemand, dass wir nur in einer Fortentwicklung dessen, was wir jetzt für richtig ansehen, diese Welt stabilisieren
können? Glaubt irgendjemand, dass wir unseren Ressourcenanspruch beibehalten können?
Ein anderes Wort für Frieden: Nachhaltige Entwicklung
Der Friedensnobelpreisträger von 2006, Mohammed Yunus, sagt, dass die Einkommensverteilung der Welt eine sehr deutliche Sprache spricht: 94 % des weltweiten Einkommens erhalten 40 % der Weltbevölkerung, während 60 % der Menschen mit dem Rest auskommen müssen. Und Yunus sagt: „This is no formula for peace“ – dies ist keine Grundvoraussetzung für Frieden. In seiner Dankesrede für den Nobelpreis – die ich zu lesen empfehle – bestätigt er das, was Papst Paul VI. bereits gesagt hat: Entwicklung ist der neue Begriff für Frieden. Aber es kommt noch etwas hinzu, wir müssen offenbar etwas weiter gehen. Heute würde Paul VI. möglicherweise und hoffentlich sagen: Nachhaltige Entwicklung ist der neue Begriff für Frieden.
Was bedeutet das? Konkret, dass die Ballons im nördlichen Teil der Welt offenbar auch dadurch ermöglicht wurden, dass die Kosten, die mit diesem Wohlstand verbunden sind, nicht in den Preisen voll enthalten sind, die dort dafür gezahlt werden. Man hat sich daran gewöhnt, einen Teil der Kosten an andere weiterzureichen.
Eine der alten Dummheiten ist es, zu argumentieren, Umweltpolitik würde Kosten verursachen. Umweltpolitik verursacht nicht Kosten, sondern Umweltpolitik ist Verteilungspolitik. Umweltpolitik entscheidet darüber, wann und wer die Kosten trägt. Wenn wir keine Kläranlagen bauen, könnte man sagen, wir sparen Kosten, aber dann gibt es Abwasser und das hat Konsequenzen. Wenn heute die Kläranlage nicht gebaut wird, muss davon ausgegangen werden, dass die Bearbeitung dieser Schadstoffe zunächst einmal der Natur überantwortet wird. Die Natur hat so etwas wie eine natürliche Assimilationskraft, eine Aufnahmefähigkeit – bis sie umkippt. Indem wir die Natur belasten, können andere sie nicht mehr nutzen. Das heißt, wenn ich in den Oberlauf eines Flusses ungeklärtes Abwasser einleite, kann ich am Unterlauf des Flusses das Wasser nur nutzen, wenn ich dort investiere. Das Wasser des Rheins geht von der Schweiz bis zum Ärmelkanal durch neun menschliche Mägen: Irgendwo muss es also geklärt werden. Im Umweltbereich verlagern wir noch viele Kosten, wir müssen uns fragen, wann und wer dafür bezahlt. Wir können den Rhein begradigen und gewinnen große Vorteile für die Schifffahrt und für das Siedlungswesen, aber das Wasser fließt dann schneller ab und die Wahrscheinlichkeit von Hochwassern ist am Unterlauf entsprechend höher. Dort trägt man die Kosten für die Vorteile weiter oben.
Wir wälzen Kosten auf andere ab. Das ist die Situation, die ja eine weitgehende ethische Komponente und eine außerordentlich weitgehende Sicherheitskomponente hat. Verteilungspolitik ist immer eine Politik, die möglichen Konflikten vorbeugen will. Niemand zahlt gerne für den Wohlstand der Anderen, dem wird er sich irgendwann verweigern. Yoweri Kaguta Museveni, der Präsident Ugandas, vergisst in allen seinen Reden nicht darauf hinzuweisen, dass er in seinem Land eine größere Farm habe, umgeben von einem Zaun.Würde einer seiner Nachbarn auf die Idee kommen, den Abfall über den Zaun auf seine Farm zu werfen, würde er ihm sagen: Mein Freund, morgen ist der wieder weg oder wir haben Ärger. Und Museveni sagt, ihr in den hoch entwickelten Ländern macht nichts anderes. Ihr schmeißt euren Abfall bei uns hin, aber ihr kümmert euch nicht darum, was damit passiert. In manchen Bereichen ist der Abfall sogar wörtlich zu nehmen. Wir haben nach der Öffnung der Mauer, nach der Überwindung der Bipolarität in geradezu unverantwortlicher, krimineller Weise Sondermüll von dem hoch entwickelten Westen nach Osten verschoben. Als Bundesminister musste ich einmal nach Siebenbürgen reisen, denn Greenpeace hatte aufgedeckt, dass dort in unverantwortlicher Weise Giftmülltonnen aus der alten Bundesrepublik in der Gegend herumlagen. Wir haben sie, mit viel Geld, zurückgeholt. Dann haben wir, wie das üblich ist, wenn man etwas für die Zukunft vermeiden möchte, eine Konvention – die Baseler Konvention – vereinbart. Aber das heißt ja nicht, dass diese kriminellen Vorgänge beendet wären. Die Abwälzung der Kosten von den Reichen auf die Armen wird immer wieder versucht. Vor nicht langer Zeit hat ein Giftschiff aus Rotterdam an der Elfenbeinküste angelegt und dort Giftmüll deponiert, Menschen sind daran gestorben. Ich nenne dies eine ökologische Aggression, das ist eine Kriegsführung der Reichen, eine Abwälzung der Kosten.
Klimawandel ist eine Frage der Verteilungspolitik
Das Gleiche geschieht im Klimabereich. Beim Klimawandel sind die Täter in CO2 und Methan dingfest gemacht. Ich hätte vergleichsweise keine große Sorge, wenn diese Emissionen von Schadstoffen sich so verhalten würden, wie sich etwa Schwefeldioxid verhält. Damit gab es auch mal Probleme: bei der Verbrennung von Kohle wird Schwefeldioxid freigesetzt, der sauren Regen verursacht und Wälder und Böden schädigt. Wir haben dann Vorschriften geschaffen, die Grenzwerte für den Ausstoß von Schwefeldioxid bei Kohlekraftwerken festlegten. Nebenbei: Damals hat mir die Kohlestromwirtschaft mitgeteilt, das sei das Ende der Kohleverstromung in Deutschland. Es sei so teuer, das könne man nicht machen. Es gibt immer noch Kohlekraftwerke in Deutschland.Die Erfahrung: Grenzwerte dort, wo es keine gab, lösen einen Technologieschub und Verhaltensänderungen aus, nicht Wegrennen. Der Vorteil bei Schwefeldioxid ist aber, dass nicht die Emission – der Ausstoß nach oben – so entscheidend ist, sondern die Immission, der Niederschlag des Schadstoffes „unten“. Man konnte genau berechnen, wie hoch ein Schornstein sein muss, damit der Schadstoff weit genug verteilt wird. Das wurde Hochschornsteinpolitik genannt. Beim Wasser gibt es das Gleiche: In Portugal wird eine „Hochschornsteinpolitik“ in horizontaler Weise gemacht mit langen Abwasserleitungen ins Meer.
Der Unterschied von Schwefeldioxid zu CO2 besteht darin, dass diejenigen, die CO2 in die Luft lassen, die emittieren, nicht diejenigen sind, die von den damit verbundenen negativen Konsequenzen als Erste betroffen sind. Nicht die Frage, wie man die Emission gestaltet, ist die Problematik, sondern die Emission als solche ist das Problem. Und die Kosten für den dadurch ausgelösten Klimawandel zahlen die Länder in den wenig entwickelten Regionen der Erde jetzt schon. Sie sind in besonderer Weise die Opfer. Damit ist Klimawandel eine Frage der Verteilungspolitik. Die Deutsche Bischofskonferenz hat in dem von ihr 2006 herausgebrachten Expertentext zum Klimawandel dieser Verteilungswirkung drei Gerechtigkeiten gegenübergestellt:
- Schöpfungsgerechtigkeit – Was muten wir der Schöpfung zu? Was wälzen wir von den Kosten unserer Lebensweise auf sie ab? Wie weit verbrauchen und überfordern wir ihreAufnahmefähigkeit von Umweltschäden?
- Intergenerative Gerechtigkeit – Was wälzen wir, bewusst oder unbewusst, an Kosten auf die kommende Generation ab? Der Klimawandel wird uns noch nicht so sehr, aber besonders stark die nächste Generation treffen. Wir verschieben die Kosten auf sie.
- Weltweite Gerechtigkeit – Andere in der Welt, nicht die Verursacher, tragen die Kosten.
Also ist Entwicklung der neue Begriff von Frieden. Aber nicht so, dass unsere Entwicklung die Entwicklungsfähigkeit anderer – sei es, dass sie jetzt, sei es, dass sie in Zukunft leben – in Frage stellt.
Ich bin ein großer Bewunderer von Hans Jonas, dem deutschen jüdischen Philosophen, geboren 1903, 1933 dem Irrsinn des Nationalsozialismus entflohen (seine Mutter wurde in Auschwitz ermordet), später wurde er Ehrenbürger seiner Heimatstadt Mönchengladbach, er starb 1993 in New York. In seinem großen Werk „Das Prinzip Verantwortung“ entwickelte er Kants Kategorischen Imperativ weiter, indem er formulierte: „Handle so, dass die Konsequenzen deines Handelns im Einklang stehen mit der Permanenz menschlichen Lebens auf Erden.“ Übrigens: Die erste Enzyklika des Papstes Benedikt XVI., Deus Caritas Est, setzt sich zum Teil mit Jonas’ Maxime auseinander.
Die Abwälzungsmentalität durch das „Prinzip Verantwortung“ ersetzen
Ich bin der Überzeugung, Klimawandel ist auch eine Frage des „Klimawechsels“. Wir müssen offenbar wechseln, verrücken, das Modell von Wohlstand und Wachstum, das darauf aufbaut, die Kosten dieses Wohlstandes abzuwälzen auf andere und auf die Zukunft, ablösen. Denn dieses Abwälzen ist ein wesentlicher Teil des „no formula for peace“. Deswegen war die Entscheidung richtig, nach dem Friedensnobelpreis für Mohammed Yunus diesen Preis denen zu geben, die sich in besonderer Weise mit der Frage des Klimawandels, mit der Abwälzungsproblematik beschäftigen.
Wir zerstören Lebensmöglichkeiten und berauben durch das veränderte Klima Menschen ihrer Heimat. Bereits gegenwärtig gibt es mehr Klimaflüchtlinge als Flüchtlinge aus anderen Gründen. Ihre Zahl wird deutlich weiter ansteigen mit den zunehmenden Niederschlagsveränderungen. (Nebenbei: Gestern hat es mich umgehauen. Im Zug nach Berlin wurde auch die BILD-Zeitung angeboten. Ihr Aufmacher: Neuer Umweltschocker – die Antarktis bricht auseinander! Und da stand in großen Lettern: SORGE UM DIE PINGUINE.) Wir müssen also die Frage einer nachhaltigen Entwicklung auch als ethische Herausforderung begreifen, denn wir werden ganz offenbar den Frieden nicht erhalten können, wenn wir das Abwälzen der Kosten nicht beenden. Das gilt besonders für den Klimawandel, es betrifft aber andere Komplexe ebenso: die Abfallfrage oder die Erhaltung der Artenvielfalt. Wir verlieren Arten in dem Maße, wie wir sie eben nur nach dem gegenwärtigen ökonomischen Wert betrachten.
Die Abwälzungsmentalität dabei ist bemerkenswert: In Nairobi fand die Konferenz für eine Konvention zum Schutz des Handels mit gefährdeten Arten statt. Alle Europäer waren der Überzeugung, man müsse den afrikanischen Elefanten unter Schutz stellen, denn wenn Elfenbein zu einem Handelsgut wird, werden Elefanten gewildert. Man darf also mit Elefanten, auch wenn sie gestorben sind, und mit ihrem Elfenbein nicht handeln. Deshalb wird nun z.B. in Nairobi an einem besonderen Platz das Elfenbein verbrannt, natürlich kostenlos. Wäre ja noch schöner, wenn wir dafür etwas bezahlen würden! Der afrikanische Elefant wurde tatsächlich unter Schutz gestellt. Die Afrikaner waren sehr zurückhaltend, sie sagten: Es gibt immer mehr Elefanten, denn sie haben keine natürlichen Feinde mehr. Am selben Tag, an dem in Nairobi der Schutz der Elefanten beschlossen und in der Öffentlichkeit stolz verkündet wurde, wurde bei Hamburg ein Naturschutzgebiet aufgehoben, in dem bis dahin ein kleiner Vogel geschützt wurde. Ein Hamburger Taxifahrer sagte mir: „Haben Sie das gehört, die wollten die Natur schützen wegen so einem Vogel, den noch keiner gesehen hat, dabei soll da der Airbus gebaut werden.“ Hätte dieser Vogel seinen Lebensraum in Afrika gehabt, hätten alle, auch der Taxifahrer, dafür gestimmt, ihn unter Schutz zu stellen. Wir verlegen den Schutz gerne zu denen, die in besonderer Weise ökonomische Schwächen aufweisen. Das ist das Klima, in dem wir leben. Wir brauchen einen Klimawechsel, den wir politisch gestalten müssen.
Immer mehr ökonomisch und gesellschaftlich bedeutsame Faktoren stellen sich global dar. Peter Hain, ehemaliger Staatsminister im britischen Außenministerium, sagt in seinem Buch „The End of Foreign Policy?“, dass es immer mehr Dinge gibt,die jenseits des influsses eines einzelnen Staates stehen. Das Klimaproblem ist nicht mehr von einem Staat zu bewältigen: Es befindet sich, staatlich gesehen, jenseits der Gestaltungsfähigkeit.
Das gilt auch für viele andere Fragen wie z.B. die Globalisierung der Information. Im staatlichen Fernsehprogramm in Nairobi laufen die Soap Operas aus Hollywood, die bei uns vor 15 Jahren gelaufen sind, und treffen auf einen völlig anderen kulturellen und sozialen Zusammenhang. Die Volksentwicklung in Brasilien, die demografische Umkehrung, hat nicht unerheblich mit der Weitergabe globaler Informationen durch das Fernsehen in diesem Land zu tun. Alle sagen – ich auch –, das Internet muss frei sein; und wenn China den freien Zugang zum Internet begrenzen möchte, halten wir das für falsch. Aber festzustellen ist, dass die Information und alle Internetinhalte jenseits des Einflusses einzelner Staaten liegen. In drastischer und besorgniserregender Weise mussten wir das bei der Krise der Hypothekenbanken in den USA beobachten mit ihren globalen Konsequenzen. Das geradezu asoziale Verhalten einiger, die so viel wie möglich Schulden anhäufen, dann für sich die hohen Erträge einstreichen, und wenn es schiefgeht, die Schadensbehebung dem Staat überlassen: mit globaler Wirkung. Da wird man nachdenklich.
Immer mehr zeigt sich, dass der nationale Staat eben nicht hinreichend handeln kann, mit der Konsequenz, dass die Bürger sagen, der Staat kann alles machen, nur nicht das, was relevant für mein Leben ist. So kann der nationale Staat nur dort noch unabhängig Steuern erheben, wo der Steuertatbestand immobil ist. Der Konsum wird besteuert, weil er immobil ist, also größtenteils im Land stattfindet. Kapital ist aber mobil, also wird es nicht oder niedrig besteuert, um es nicht über Grenzen abwandern zu lassen.
Eine Weltinnenpolitik?
Wie also bekommt man die globalisierte Welt in den Griff? Für mich war das ein Grund, mich der globalen Politikgestaltung zu nähern: bei den Vereinten Nationen. Wie müssen wir die weiterentwickeln? Wo sind die Entscheidungslinien in einer mehr und mehr globalisierten Welt aufzufangen?
Visionäre Menschen haben – aus verschiedenen Gründen – versucht, das in Europa zu beantworten. Es wäre eine der großen tragischen Entwicklungen, wenn der Einigungsprozess in Europa zum Stillstand käme. Wir müssen offenbar noch sehr viel weitergehen. Die globale Entwicklung errichtet so etwas wie eine Oligopolisierung. Einzelne große Gruppen, die nicht in ein eigenes Oligopol hineinkommen, wie die Länder Afrikas, zahlen die Zeche. Wir müssen uns also Gedanken darüber machen, wie Politik auf globale Wirkungen reagieren kann – denn das Instrumentarium dafür ist nicht oder noch nicht hinreichend ausgearbeitet. Die Frage, wie die Vereinten Nationen weiterentwickelt werden, ist deshalb von zentraler Bedeutung.
Ebenso im Handelsbereich: mit der Weltbank, dem Internationalen Währungsfonds, der Welthandelsorganisation – wie können sie weiterentwickelt werden? Viele kritisieren die Welthandelsorganisation, aber noch schlimmer wäre es, wenn sie abgeschafft oder übergangen würde: Dann würden bilaterale Regelungen vereinbart, das wäre das Schlimmste für die Entwicklungsländer.
Die Frage, wie wir diese Weiterentwicklung schaffen, ist noch offen. Es muss eine sein, die stärker in die Willensbildung der Bevölkerung dieser Welt eingebunden ist. Wir werden keine Weltregierung bekommen. Aber es wäre gut, wenn wir eine Entwicklung zu einem föderativen System hätten. Wenn wir die Frage nach der Entwicklung der Vereinten Nationen nicht lösen, wird die Politikverdrossenheit noch deutlich zunehmen: Die Zustimmung zur Demokratie nimmt jetzt schon ab, auch in Deutschland. In den neuen Bundesländern halten nur noch knapp über 50 Prozent die Demokratie für die beste Staatsform, in den alten Ländern sind es noch ein wenig mehr. Aber bei Kommunalwahlen ist eine Wahlbeteiligung über 50 Prozent schon eine Sensation.
Unsere Gestaltungskraft ist gefragt
Wenn man diese Fragen an die Politik richtet, sollte man sich auch selbst, auch als Mitglied im Bund Neudeutschland, fragen, was man dazu beiträgt, damit die Demokratie die Handschrift bekommt, die man sich wünscht. Ein Schweizer Rechtsgelehrter hat den schönen Satz gesagt, die Bevölkerung erhebe gegenüber den Politikern die Kritik, warum die Politiker nicht so sind, wie die Menschen der Bevölkerung eigentlich sein müssten.
Wir – im Bund Neudeutschland – fühlen uns verpflichtet, Werte in die Gesellschaft, in die Politik einzubringen. Deshalb meine ich: Wir dürfen nicht nur beobachten, sondern wir müssen mitgestalten. Der Klimawandel ist der Anlass, über einen „Klimawechsel“ in der globalen Welt nachzudenken und ihn zu gestalten. Wir dürfen nicht nur überlegen, was mit Technik besser zu machen ist, nicht nur nach mehr Effizienz fragen, sondern auch nach Suffizienz: Was ist genug? Kann es auf Dauer so sein, dass wir bei einer rückläufigen Bevölkerung wirtschaftliche Wachstumsraten brauchen, um Stabilität in der Altersvorsorgung zu erhalten? Welche Wachstumsraten sollen denn die Länder anstreben, die jetzt mit einem Zehntel unseres Wohlstandes auskommen müssen, damit sie diesen Unterschied aufholen, während wir gleichzeitig sagen, wir brauchen für uns noch mehr Wachstum?
Können wir weiter eine Einwanderungspolitik betreiben nach dem Grundsatz, wir brauchen die, die uns nützen, nicht die, die uns ausnützen? Eine Regelung besagt, dass nur die ausländischen Arbeitskräfte eine Aufenthaltsberechtigung in Deutschland erhalten, die ein Jahreseinkommen von mindestens 85.000 Euro nachweisen können. Das sind genau die, deren geistiges Kapital in ihren Heimatländern dringend gebraucht wird, um dort die wirtschaftliche Entwicklung voranzubringen, damit der Druck der Wanderungsbewegung nach Europa geringer wird. Das kann nicht richtig sein. Also sind wir mit unserer Verantwortung und Gestaltungskraft gefragt.
In unserer Kirche wird immer wieder die Frage gestellt, ob sie eine Kirche für die Menschen oder für die Schöpfung ist. Der wunderbare Heilige aus Assisi schrieb über Erde, Sonne, Mond und Quelle als Schwestern und Brüder. Ist uns bewusst, dass der Römerbrief ausdrückt, die ganze Schöpfung harre der Erlösung? Ist uns bewusst, dass Schöpfung auch deswegen zu erhalten ist, weil sie Schöpfung ist, nicht weil sie den Menschen nützt? Und was bedeutet denn nützen? Wie viel hat sich schon als extrem nützlich herausgestellt, von dem viele geglaubt haben, es sei gänzlich unnütz. Wer sind wir eigentlich, dass wir mit unserer gegenwärtigen Nützlichkeitsvorstellung das betrachten, was Gott geschaffen hat?
Auf dass es bleibe auch für die, die nach uns kommen! Nicht Abwälzung, sondern Ehrlichkeit in der Erarbeitung unseres Wohlstandes ist gefragt.
Redaktionell bearbeitete Mitschrift des Vortrags vom 28.03.2008 in Halle.
Bbr. Professor Dr. Klaus Töpfer war Bundesminister für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit und für Raumordnung, Bauwesen und Städtebau. Von 1998 bis 2006 war er Unter-Generalsekretär der Vereinten Nationen und Exekutivdirektor des UN-Umweltprogramms (UNEP) in Nairobi.